Die Lebensführung war bis ins Detail geregelt
Dr. Gaby Lindenmann-Merz hielt einen Online-Vortrag über Rituale im Alltag der Zisterzienser
Kloster Eberbach. (chk) –
Eine einheitliche Lebensführung mit klar geregelten Strukturen war das Bestreben des Zisterzienserordens. Auf Einladung des Freundeskreises Kloster Eberbach erläuterte die anerkannte Expertin für Klosterarchitektur und klösterliches Leben, Dr. Gaby Lindenmann-Merz, in einem Online-Vortrag, wie sich die Regeln für den Tagesablauf der Zisterzienser gestalteten. Unter dem Motto „Rituale im Alltag“ ging es um alltägliches und liturgisches Händewaschen und profane Toilettengänge. Außerdem erfuhr das Online-Publikum weitere Details über Zisterzienserklöster und speziell über Eberbach.
Doris Moos, Vorsitzende des Freundeskreises Kloster Eberbach, und die stellvertretende Vorsitzende, Hilke Roßkamp, begrüßten die Referentin und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich zu dem Live-Vortrag zugeschaltet hatten. Seit der Corona-Pandemie hat der Freundeskreis einen jährlichen Online-Vortrag im Januar beibehalten, an dem auch Interessierte teilnehmen können, die weiter entfernt wohnen. Da Wasser eine zentrale Rolle in dem Vortrag spielte, erklärte Doris Moos vorab, dass dies für die Zisterzienser immer ein Hauptfaktor gewesen sei, wenn sie die Standorte ausgewählt hätten. Sie bauten ihre Klöster in abgelegenen Tälern, wo sie Quellen und Bäche vorfanden. In Eberbach stießen sie auf den Kisselbach und eine Quelle im Wald, die sie in einem raffinierten unterirdischen System zu den Entnahmestellen im Kloster leiteten. Die Zisterzienser waren im 12. Jahrhundert ihrer Zeit weit voraus und verstanden es, sich die Wasserkraft wirtschaftlich in Werkstätten und Mühlen nutzbar zu machen, wie auch das Wasser zum Kochen zu verwenden. Wie es für hygienische und rituelle Zwecke zum Einsatz kam, stand im Mittelpunkt des Vortrags.
Die Vorsitzende bezeichnete Gaby Lindenmann-Merz, die in Karlsruhe lebt und arbeitet, als „wunderbare Ansprechpartnerin“, die neue Ansätze für weitere Forschungen auch ins Kloster Eberbach gebracht habe. Sie hat viele weitere Klosteranlagen besucht und deren Funktionsbauten erforscht, und hatte Vergleiche aus anderen deutschen und europäischen Klöstern mitgebracht. Zu Beginn ihres Vortrags zeigte sie den Plan eines typischen Zisterzienserklosters, der für alle Niederlassungen des Ordens eine Richtschnur bildete. Auch stellte sie Pläne für den geregelten Tagesablauf vor. „Der Alltag war klar strukturiert und konnte nach Wochentag und Jahreszeit variieren.“ Alle Handlungen waren durch feste Regeln bestimmt. Das vorgeschriebene Händewaschen vor den Mahlzeiten sei eine Routine gewesen, die den Alltag bestimmte, könne aber auch als rituelle Handlung der Reinigung gedeutet werden, erklärte sie.
Am Beispiel des Mutterklosters in Citeaux und anderer europäischer Zisterzienserklöster konnte sie nachweisen, dass das Refektorium – der Speisesaal – und das Brunnenhaus nahe beieinander lagen. So war es auch im Kloster Eberbach, bevor das Brunnenhaus abgetragen wurde. Der Brunnen steht frei auf der Wiese, doch das Fundament um den Brunnen herum weist noch auf das einstige Brunnenhaus hin. An diesem Brunnen in der Nähe des Refektoriums trafen sich die Mönche, um ihre Hände vor dem Essen zu waschen.
„Auch Haare schneiden, Tonsuren schneiden und Rasur fanden im Brunnenhaus statt“, berichtete die Referentin. Die ebenfalls genau geregelten Fußwaschungen hätten samstags stattgefunden. Auch Wannenbäder seien reglementiert gewesen. Sie fanden vermutlich nicht in den Brunnenhäusern statt, sondern in den Infirmerien, wo erkrankte Klosterbewohner gepflegt wurden, oder bei den Latrinenhäusern. „Das zentrale Brunnenhaus war den Mönchen vorbehalten. Den Laienbrüdern standen andere Zugriffsmöglichkeiten auf frisches Wasser zur Verfügung, aber solche Brunnenstellen sind weniger klar und kaum in ‚üblicher‘ Disposition zu greifen, anders als das Lavatorium – das zentrale Brunnenhaus im Kreuzganggeviert der Mönche“, ergänzte sie. Das sei auch nicht die einzige Frischwasser-Entnahmemöglichkeit gewesen, denn auch Küchen hätten beispielsweise über Anbindungen an frisches Quellwasser verfügt. Neben dem alltäglichen Händewaschen aus vorrangig hygienischen Gründen habe es in den Kirchen Becken für liturgische Handwaschungen gegeben, Piscinen genannt. Auch in der Eberbacher Basilika befinden sich solche Becken oder die Spuren ehemaliger Piscinen in sogenannten Kredenznischen unter Rundbögen, beispielsweise in der Nähe des Hochaltars und in den Querarmkapellen. Das zur Reinigung der Hände benötigte Wasser war vor und nach der Kommunion voneinander getrennt zu entsorgen und durfte nicht direkt dem Erdreich zugeführt werden. Auch für die Reinigung von liturgischen Gerätschaften und Tüchern waren genaue Regeln formuliert.
Stattliche Latrinenbauten
Die Latrinenbauten im Kloster Eberbach sind ebenfalls nicht mehr erhalten, aber aufgrund von Grabungen sind die Standorte nachgewiesen. „Die Latrinenbauten waren stattliche Gebäude“, betonte die Referentin. Sie lagen am Ende der Dormitorien am Nordteil des Klosters. Der Latrinengang habe im Gemeinschaftsraum stattgefunden und selbst für die Notdurft habe es genaue Regeln gegeben. Man solle die Gesichter mit den Kapuzen bedecken, war beispielsweise eine davon. Nachts sollte immer ein Licht in der Latrine brennen und Novizen sollten nachts nicht alleine die Toiletten aufsuchen, sondern ihren Magister wecken. Als „Toilettenpapier“ dienten Moos, Blätter oder auch Schwämme, die wieder ausgewaschen wurden. Ihren Vortrag bebilderte Gaby Lindenmann-Merz nicht nur mit Skizzen und Fotografien von baulichen Zeugnissen, sondern auch mit alten Zeichnungen, auf denen beispielsweise Szenen mit Waschungen dargestellt waren. Außerdem gab sie viele Literaturhinweise für alle, die sich weiter mit diesen Themen beschäftigen wollen.
Am Ende des Vortrags beantwortete sie noch einige Fragen und erhielt viel Lob für ihren aufschlussreichen Vortrag. Im Chat kam viel positives Feedback, auch von Teilnehmerinnen aus weiter entfernten Klöstern.
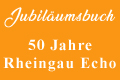



Kommentar schreiben